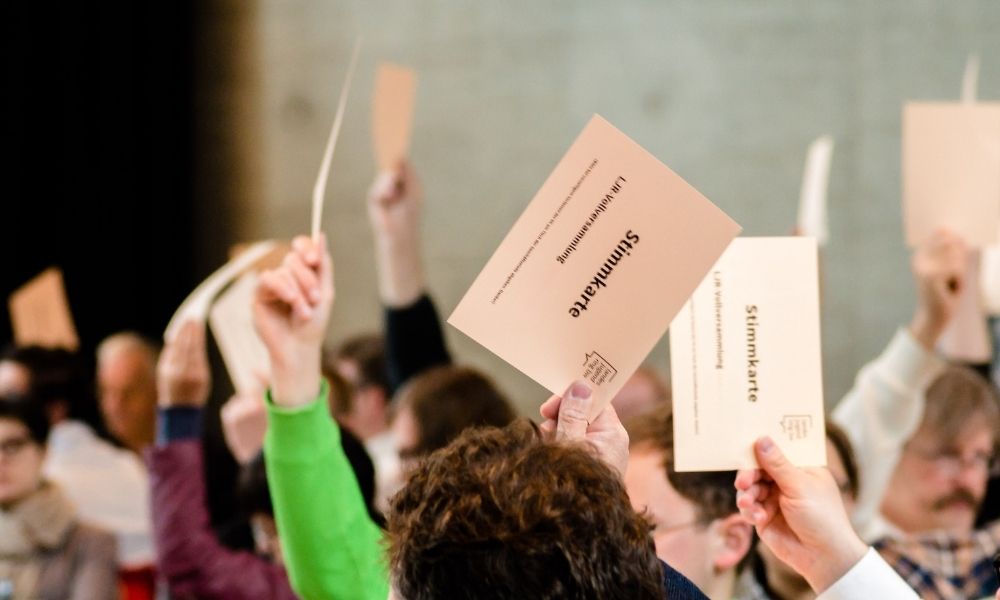Gemeinsame Stellungnahme von
- Landesjugendring Baden-Württemberg (LJR)
- Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (AGJF),
- Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung (LAGO),
- Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) mit jugend@bw,
- Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (LAG JSA),
- Arbeitsgemeinschaft der Landjugenden (AGL) und
- Akademie der Jugendarbeit BW.
Einleitung
Die Jugendverbände, die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und die Angebote der kulturellen Jugendbildung nehmen in der Medienbildung junger Menschen eine wichtige Funktion ein. Beispielsweise in Jugendgruppen oder im Rahmen eines Offenen Angebots werden Informationen gesammelt und aufgearbeitet, gemeinsam Pläne gemacht und kreative Methoden angewandt. Teamarbeit steht hier immer im Vordergrund – so werden nicht nur kognitive, sondern auch soziale Kompetenzen geschult.
Wir Landesorganisationen der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sehen Medienbildung als Querschnittsaufgabe und damit als wichtigen Teil einer umfassenden Persönlichkeitsbildung. Diese sind nicht gleichzusetzen mit den Bildungsmöglichkeiten der Schule. Die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit bieten für ihre jeweiligen Zielgruppen Möglichkeiten, selbstbestimmt Erfahrungen zu sammeln.
Diese Erfahrungsräume sind wichtige Elemente im Prozess des Erwachsenwerdens. Vor allem aber bietet die Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit jungen Menschen unverzweckte, geschützte Räume, in denen sie sich ausprobieren können und gleichzeitig vom Fachwissen und der pädagogischen Begleitung durch Haupt- und Ehrenamtliche profitieren. Schule, die andere Aufgaben und Ziele verfolgt, kann solche Erfahrungsräume nicht bieten.
Gleichzeitig hat Digitalisierung als gesellschaftliche Aufgabe auch Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, denn diese ist ohne digitale Medien nicht mehr möglich.
1. Situation
1.1 Relevanz von Mediennutzung
Digitalisierung ist ein wesentlicher Treiber des aktuellen Wertewandels und sozialer Transformationsprozesse. Gerade aufgrund des hohen Entwicklungstempos technischer Neuerungen und der Konsequenzen für zentrale gesellschaftliche Bereiche (Arbeitswelt, Bildung, Erziehung, Kommunikation, Alltagsorganisation, Mobilität etc.) sind die Auswirkungen umfassend und betreffen fast alle Facetten unserer Lebenswelt. Auch im Alltag von Jugendlichen sind digitale Medien heute nicht mehr wegzudenken […] – sie leben online.
(SINUS Jugendstudie 2016)
Eine gute Medienausstattung ist für junge Menschen genauso selbstverständlich, wie die ständige Verfügbarkeit von Internet und Möglichkeiten zum Austausch mit Peers und der Zugriff auf Informationen und Unterhaltung. Gerade für junge Menschen mit Behinderungen gibt es heutzutage vielfältige Möglichkeiten der (medial vermittelten) Teilhabe – das Inklusionspotenzial digitaler Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist enorm und leider noch in großen Teilen ungenutzt.
Aus der sozialen Relevanz ergeben sich weitergehende Aspekte von Mediennutzung: Gesellschaftliche Mitgestaltung und Mitsprache findet oft medienvermittelt statt. Neben kreativem, selbstbestimmtem und kritischem Umgang mit Medien und den dazugehörigen „Alltagskompetenzen“ gilt es also auch, partizipative Aspekte des Mediengebrauchs in den Blick zu nehmen. Aktive Medienarbeit kann Türöffner und ein wertvolles Instrument zur Aktiven Mitgestaltung sowie zur Teilhabe an der Gesellschaft sein.
Entsprechend steigen auch die Anforderungen an Software-Kenntnis und Technik-Know How für junge Menschen und damit auch an betreuende Fachkräfte oder Ehrenamtliche.
1.2 Der Beitrag der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
Die Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist ein wichtiger Ort für die Medienbildung von Kindern und Jugendlichen. Sie bietet das richtige Setting, um auf der Grundlage selbst produzierter Materialien verantwortungsvolle und qualitätsorientierte Formen des Umgangs mit Medien zu erfahren. Es werden Zeit- und Handlungsspielräume erschlossen, wie die Gestaltungsfreiheit bei Themenwahl, Ausdrucksform und Arbeitsweise, die Balance von Prozess- und Produktorientierung, Zeit für soziales und emotionales Lernen und für Reflexion, Integration von Bildern, Musik, Sprache und Körpersprache. Weitere Themen, für die sich Aktive Medienarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit anbietet, sind Umgang mit Desinformationen/Fake News und Recherchekompetenz, die in einem für junge Menschen unkomplizierten Rahmen erprobt werden können.
Besonders für junge Menschen in benachteiligten Lebenslagen ist Aktive und eigenkreative Medienarbeit wichtig. Sie können ihre lebens- und medienweltlichen Erfahrungen sowie vorhandene Potenziale im visuellen, audiovisuellen und körpersprachlichen Ausdruck gut einbringen. Gleichzeitig bedarf es hier einer guten Begleitung und einer intensiven Beziehungsarbeit, um junge Menschen in der Nutzung digitaler Medien zu stärken. Medienkompetenzbildung in non-formalen und informellen Settings trägt zum Selbstschutz bei, klärt über Risiken auf, schützt vor digitaler Ausgrenzung und Diskriminierung und ermöglicht digitale Teilhabe. Des Weiteren zählt eine inklusive Arbeit mit jungen Menschen zu wichtigen Bausteinen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit.
Der gesetzliche Rahmen dazu ist das SGB VIII. Pädagogisch aufgegriffen werden diese Vorgaben in den Richtlinien der Digitalen Jugendarbeit der EU. Digitale Medien bzw. digitale Medienarbeit sind keine bloße Methode, sondern sind integriert in die alltägliche Arbeit. Sie funktionieren nach den gleichen Grundlagen wie die übliche Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit; digitale Medien sind Werkzeug, Aktivität oder Inhalt.
Eine pädagogische Auseinandersetzung mit der Digitalisierung sollte sich nicht zuletzt durch den lebensweltlichen Bezug der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ergeben. Forderungen dazu wurden auch vom Bundesjugendkuratorium im Frühjahr 2021 erstellt. Neben der Beteiligung und den Schutzrechten von Kindern und Jugendlichen wurde eine nachhaltige Förderung angemahnt.
1.3 Medienkompetenz vermitteln – wie, wo, wann?
Medienkompetenz ist Alltagskompetenz. Ihre Vermittlung darf daher nicht nur auf ihren Nutzen hin, also die Anwendungsmöglichkeiten in Schule und Beruf verstanden werden. Medien aktiv und gestaltend für die eigenen Bedürfnisse einzusetzen, verändert nicht nur das Mediennutzungsverhalten junger Menschen, sondern auch die Fähigkeit zur Medienkritik. Darüber hinaus können Medien nur mit entsprechender Kompetenz erfolgreich als Möglichkeit zur Meinungsäußerung, zur freien Entfaltung, als Medium zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit und nicht zuletzt als Mittel zur Demokratieerziehung und -gestaltung wahrgenommen werden. Somit ist sie Grundlage für eine gesellschaftliche Entwicklung, die alle junge Menschen betrifft und die diese mitgestalten sollten.
Es stellt sich also nicht die Frage ob, sondern wie eine umfassende Medienbildung für junge Menschen gestaltet werden soll. Hier den Blick auf Schulen zu verengen, greift zu kurz – denn 60 bis 70 Prozent unseres Wissens erwerben wir außerschulisch, in non-formalen und informellen Bildungssettings.
Viele Organisationen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit betreiben im Rahmen ihrer Angebote Medienbildung. Jedoch bestehen hier viele Bedarfe, um eine systematische Weiterentwicklung medienpädagogischer Ansätze in der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu ermöglichen. Aus Sicht der Landesverbände der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gibt es einige wichtige Ansatzpunkte für die Landespolitik, die für „verlässliche Strukturen [der Medienbildung]“[1] unbedingt berücksichtigt werden müssen:
· Die Bildungsangebote von Jugendverbänden, -ringen, der Offenen Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit sind gem. § 1 Jugendbildungsgesetz gleichberechtigt zur schulischen Bildung.
· Die Förderung der Medienarbeit im Feld der informellen und non-formalen (außerschulischen) Jugendbildung muss dem schulischen Bereich gleichgestellt sein.
· Junge Menschen müssen bei der Ausgestaltung von Richtlinien und Strategien beteiligt werden.
· Online-Angebote müssen auch in den Verwaltungsvorschriften des Landes als gleichberechtigte Angebote auftauchen und gefördert werden.
· Rechtliche Hürden für die Nutzung von Medienangeboten in der Kinder- und Jugendarbeit müssen verringert werden.
2. Wie eine Weiterentwicklung der Medienzentren Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit unterstützen kann
2.1 Den Zugang zu Medien(geräten) gewährleisten
Den kostenlosen Zugang zu Medien(geräten) im ganzen Land für Jugendgruppen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie Jugendverbänden gewährleisten und diese bei der technischen Einrichtung sowie Instandhaltung unterstützen.
Dies geschieht durch die Förderung notwendiger Neuanschaffungen, kostenlosen Internetzugangs und durch eine entsprechend hohe Dichte von (nichtkommerziellen) Verleihstationen. Hier befürworten wir den Ausbau der Stadt- und Kreismedienzentren hin zu einem starken Netzwerk von Verleihstellen.
Die Hürden der Medienausleihe für Jugendgruppen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie Jugendverbände bei den Stadt- und Kreismedienzentren müssen gesenkt werden. Insbesondere lokale Beschränkungen (Ausleihen nur für Verbände mit Sitz im Ort des Medienzentrums) müssen abgeschafft werden.
Auch muss die Ausstattung der Verleihstellen in allen Landkreisen vergleichbar sein und überall in ausreichender Anzahl Geräte wie iPads, Trickfilmboxen oder Lizenzen für Apps verfügbar sein.
2.2 Ausbau des pädagogischen Angebots der Medienzentren und Vernetzung mit weiteren Akteuren
Workshops der Medienzentren sollen auch für Jugendgruppen zugänglich sein; Verbände sollen die Angebote der Medienzentren niedrigschwellig in Anspruch nehmen können.
Synergien nutzen: auf Landesebene soll ein breites Netzwerk von Akteuren digitaler Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit dazu beitragen, medienpädagogische Angebote in der Fläche zu streuen.
In einigen Medienzentren findet wertvolle pädagogische Arbeit für junge Menschen und Jugendgruppen in offenen Settings in medienpädagogischen Kontexten statt. Dies soll ausgebaut werden, sodass sie mehr jungen Menschen zugänglich ist. Besonderer Fokus soll hierbei auf der Beteiligung benachteiligter junger Menschen und inklusiver Medienarbeit liegen.
Ein Ausbau des bestehenden Referent*innen-Pools des Landesmedienzentrums ist sinnvoll, um lokale Angebote zu ermöglichen. Hierfür müssen die Referent*innen-Profile um die Referenzen in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ergänzt werden. Referent*innen zu buchen soll auch für Träger der freien Jugendhilfe (gem. § 75 SGB VIII) kostenlos sein bzw. bezuschusst werden.
Darüber hinaus braucht es eine zentrale Informationsplattform oder aber eine gute Vernetzung der Akteure, damit Informationen zu Angeboten der Medienzentren bzw. offene Angebote anderer Akteure gut kommuniziert werden können.
2.3 Weiterbildung von Multiplikator*innen
Die Qualifizierung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit fördern, sowohl hinsichtlich der Möglichkeiten und Chancen für die pädagogische Arbeit als auch technischer und rechtlicher Grundkenntnisse.
Inklusive Medienarbeit soll pädagogischer Standard werden. Dafür braucht es eine beständige Förderung von Angeboten zu Austausch und Vernetzung sowie Fortbildungen für Hauptamtliche und ehrenamtlich Aktive.
Um ehrenamtliche Mitarbeiter*innen und Jugendleiter*innen für die Durchführung medienpädagogischer Projekte zu qualifizieren, ist eine stärkere Zusammenarbeit der Medienzentren mit den Jugendbildungsakademien und aktuellen Initiativen und Projekten (z.B. derzeit Projekt jugend@bw) wünschenswert, um z.B. flächendeckend Juleica-Kurse zum Schwerpunkt Medienpädagogik anbieten zu können. Damit möglichst viele von diesen Angeboten profitieren, sollen solche Fortbildungen auch online oder hybrid stattfinden.
Eine Zusammenarbeit ist auch hinsichtlich der Qualifizierung von Fachkräften sinnvoll, z.B. durch die Entsendung von Referent*innen für entsprechende Fortbildungen. Diese Fort- und Weiterbildungen müssen kostengünstig, lokal und niedrigschwellig sein, um möglichst viele Fachkräfte zu erreichen.
2.4 Support in einem starken Netzwerk
Ausstattungsmerkmale und Standards für die digitale Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit müssen definiert und umgesetzt werden – mit dem Blick auf vergleichbare Chancen der jungen Menschen in ihren jeweiligen Settings.
Die allermeisten Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sind im Kontext Digitalität nicht explizit geschult oder verfügen über kein spezifisches Fachwissen – bei vielen Einrichtungen und Organisationen sind nach wie vor Ressourcen hinsichtlich der Medien- und Toolnutzung knapp bemessen, weil das technische Know-How fehlt. Aus mangelhafter Ausstattung und Know-How ergeben sich oft auch datenschutzrechtliche Probleme, z.B. bei der Toolauswahl oder der Gestaltung sicherer (online-) Räume. Oftmals führen diese Umstände auch zu einer Generalverweigerung der Träger, weil Personalressourcen zur Bearbeitung dieser Fragestellungen fehlen.
Auf Landesebene braucht es daher ein starkes Netzwerk von Berater*innen, die bei der Ausstattung gemäß den zu erarbeitenden Richtlinien (s. o.) unterstützen und rechtliche Erstberatungen vermitteln und anbieten können. Dabei empfiehlt es sich, die regionalen Medienzentren, die Berater*innen aus aktuellen Projekten und andere Strukturen zu nutzen.
Weitere Bausteine einer solchen Unterstützungsleistung können IT-Support, eine „Do it yourself“-IT-Infrastruktur nach Baukasten-Prinzip oder auch zentral bereitgestellte Tools zur digitalen Medienarbeit sein. Teilweise gibt es hier für den schulischen Bereich bereits gute Lösungen (paedML), die für den Einsatz in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit angepasst werden können.